Gastkommentar: Warum die Rohstoffpartnerschaften bisher wenig gebracht haben – und was sich ändern muss
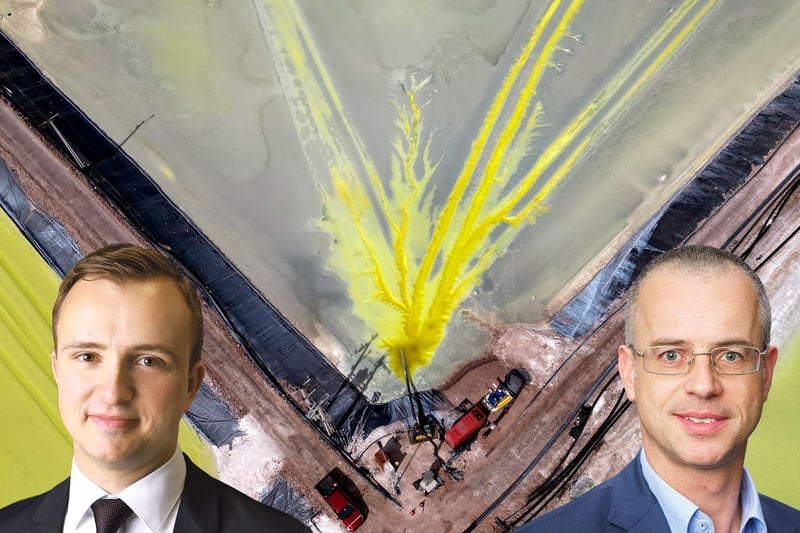
Jakob Kullik (links) ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Internationale Politik der Technischen Universität Chemnitz. Jens Gutzmer ist Direktor des Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie.
Die Bundesregierung richtet ihre Rohstoffpolitik derzeit neu aus. Ein „Weiter-so“ ist spätestens seit Russlands Überfall auf die Ukraine nicht mehr möglich. Die neue Nationale Sicherheitsstrategie und die China-Strategie haben nun auch offiziell eine geo- und sicherheitspolitische Rohstoffpolitik eingeläutet.
Ein zentrales Instrument der alten wie auch der neuen Rohstoffstrategie sind Partnerschaften mit rohstoffreichen Ländern. Die ursprüngliche Überlegung war, dass dadurch deutsche Unternehmen einen besseren Zugang zu den Märkten erhalten und Rohstoffprojekte gemeinsam mit lokalen Partnern angestoßen würden.
Im Gegenzug sollte für den privilegierten Zugang zu Rohstoffen aus strategisch wichtigen Lagerstätten die deutsche Industrie Know-how-Transfer in die Partnerländer leisten.
Aus den bisherigen und erfolglosen Rohstoffpartnerschaften lassen sich drei Lehren ziehen
So gut dieser Leitgedanke auch war, so wenig kam dabei heraus. Die Rohstoffpartnerschaften mit der Mongolei (seit 2011), Kasachstan (seit 2012), Chile (seit 2013) und Peru (seit 2014) haben ihr eigentliches Ziel – die resilientere Rohstoffversorgung der deutschen Wirtschaft – verfehlt. Im Laufe der Zeit wurden aus den einstigen wirtschaftlichen Rohstoffpartnerschaften entwicklungspolitische Nachhaltigkeitspartnerschaften.
Die Ursachen für die schlechte Bilanz sind vielfältig. Einen einzigen Schuldigen gibt es nicht. Doch der Rückblick erlaubt, Lehren aus dem Scheitern zu ziehen.
Drei Lehren sind dabei von besonderer Bedeutung:
Wir dürfen die Abhängigkeit von China nicht gegen die von anderen Ländern tauschen
Jüngste Forderungen aus rohstoffreichen Ländern nach mehr lokaler Wertschöpfung sollten dabei nicht leichtfertig als entwicklungspolitisch gerechtfertigt hingenommen werden. Auch wenn rohstoffreiche Länder künftig mehr Rohstoffe vor Ort weiterverarbeiten, sind dadurch nicht alle Probleme der Diversifizierung und der Entwicklungspolitik gelöst.
Denn was nützt es, wenn die Rohstoffabhängigkeit von China reduziert, aber dabei neue Abhängigkeiten von einzelnen afrikanischen oder asiatischen Staaten entstehen? Es muss das Ziel der Rohstoffpolitik sein, Nadelöhre in der Rohstoffversorgung zu schließen – und zukünftig zu vermeiden.

Rohstoff-Monopoly
Dass die Bundesregierung das Risiko neuer Partnerschaften dennoch wagt, ist begrüßenswert und strategisch richtig. Um es besser als bisher zu machen, gibt es mindestens drei Stellschrauben.
>> Lesen Sie hier: Diese sieben Rohstoffe sind für die klimaneutrale Wirtschaft unverzichtbar
Das federführende Bundeswirtschaftsministerium könnte in enger Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt einen Sonderbeauftragten ernennen, der für die Resilienz der Rohstoffversorgung der deutschen Industrie aus dem Ausland zuständig ist – so wäre personelle, institutionelle und strategische Kontinuität gewährleistet. Dieser könnte zudem mit den großen deutschen Wirtschaftsverbänden die Entwicklung einer resilienteren Rohstoffbeschaffung für die Industrie initiieren und koordinieren.
Schließlich könnte sich die Bundesregierung auf EU-Ebene für die Einrichtung einer EU-Rohstoffagentur einsetzen, die langfristig vielversprechende Rohstoffprojekte identifiziert und sich mit Kompetenz und Finanzmitteln an deren Entwicklung beteiligt. Solche strategischen Schulterschlüsse sind notwendig, damit die zweite Generation von Rohstoffpartnerschaften erfolgreich sein kann.






Die Autoren:
Jakob Kullik ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Internationale Politik der Technischen Universität Chemnitz.
Jens Gutzmer ist Direktor des Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie.





